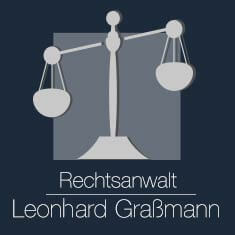Wenn Sie einen Bußgeldbescheid für einen Rotlichtverstoß aus dem letzten Sommer erhalten und sich denken: „Das ist ja schon ewig her… Ist das nicht schon verjährt?“, dann haben Sie möglicherweise recht. Versäumen die zuständigen Stellen, innerhalb bestimmter Fristen ein Bußgeld zu verhängen, kann der Verstoß verjähren, in der Regel sogar schon nach wenigen Monaten. Ihre Strafrecht Kanzlei in München erläutert hier kurz und bündig, welche Verjährungsfristen im Verkehrsrecht gelten. Kontaktieren Sie mich gerne mit Ihrem konkreten Fall für eine eingehende Beratung.
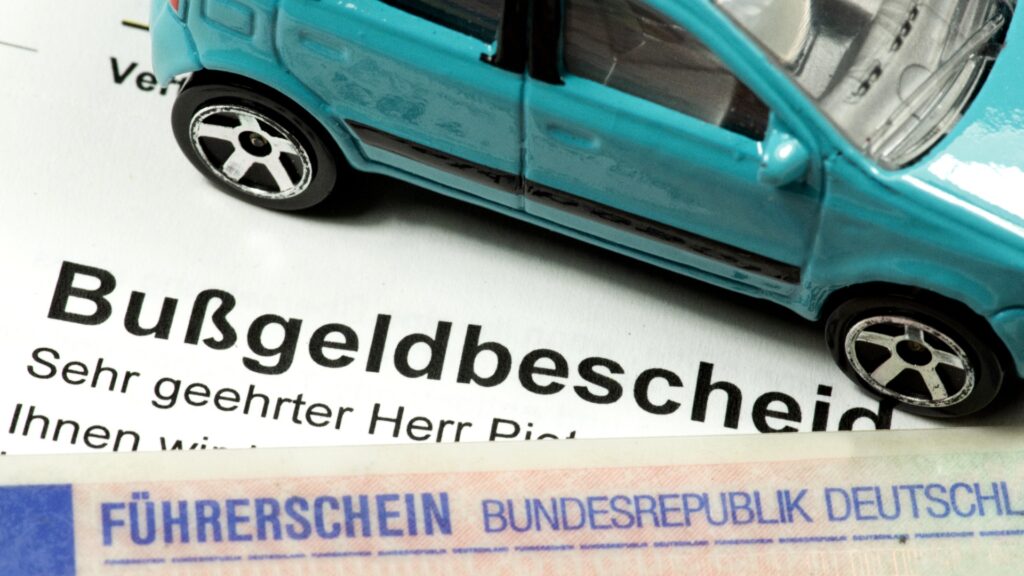
Das Wichtigste in Kürze
- Die Verjährungsfristen im Verkehrsrecht können sich je nach Verstoß unterscheiden.
- Bei Verkehrsstraftaten gelten deutlich längere Verjährungsfristen als bei Bußgeldern.
- Die Verjährung kann unterbrochen werden und die Frist kann von vorne beginnen.
Was bedeutet Verjährung überhaupt
Verjährung bedeutet, dass eine bestimmte Frist abgelaufen ist, nach der keine zivilrechtlichen Ansprüche mehr durchgesetzt werden können oder eine Straftat bzw. Ordnungswidrigkeit nicht mehr verfolgt oder bestraft werden darf. Dabei wird zwischen zwei Arten von Verjährung unterschieden:
- Die Verfolgungsverjährung bezieht sich auf die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.
- Die Vollstreckungsverjährung bezieht sich auf die Vollstreckung einer rechtsgültig verhängten Geldbuße.
Die Verjährung im Zivilrecht wird rechtlich im BGB geregelt, während die Verjährung von Straftaten im StGB festgelegt wird. Dabei gilt übrigens auch der bekannte Satz: „Mord verjährt nicht“. Für die Verjährung von Ordnungswidrigkeiten gilt das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), mit Ausnahme von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier richtet sich die Verjährung nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG). Deshalb gibt es keine allgemein gültigen Verjährungsfristen und auch die Regelungen zur Verjährungsunterbrechung sowie zum Beginn der Verjährungsfrist können sich unterscheiden.
Verjährungsfristen im Verkehrsrecht
Wann ein Verstoß im Rahmen des Verkehrsrechts verjährt, hängt maßgeblich davon ab, ob es sich um eine Verkehrsordnungswidrigkeit oder eine Straftat handelt:
- Die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten verjährt gemäß § 26 StVG nach drei Monaten ab Tatzeitpunkt, sofern kein Bußgeldbescheid ergangen ist. Hierzu zählen gewöhnliche Park- und Geschwindigkeitsverstöße. Wurde ein Bußgeldbescheid erlassen, gilt eine Verjährungsfrist von sechs Monaten ab Erlass des Bescheids.
- Eine Ausnahme bilden Verstöße nach § 24a StVG, also das Fahren unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss. Für die Verjährung von Drogen- und Alkoholordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr ist § 31 OWiG maßgeblich. Danach verjähren solche Ordnungswidrigkeiten:
- allgemein in sechs Monaten
- bei einem Höchstmaß der Geldbuße von über 1.000 bis 2.500 € in einem Jahr
- bei einem Höchstmaß der Geldbuße von über 2.500 bis 15.000 € in zwei Jahren
- bei einem Höchstmaß der Geldbuße von über 15.000 € in drei Jahren
- Die Vollstreckung von Verkehrsordnungswidrigkeiten kann ebenfalls verjähren. Hier beginnt die Frist mit der Rechtskraft der Entscheidung, die diese Rechtsfolge ausspricht. Die Verjährungsfristen betragen hier drei Jahre bis zu einem Bußgeld von 1.000 € und fünf Jahre bei höheren Bußgeldern.
- Verkehrsstraftaten verjähren gemäß § 78 StGB ebenfalls in Abhängigkeit vom möglichen Strafmaß:
- allgemein in drei Jahren
- bei Freiheitsstrafen von über 1 bis 5 Jahren in fünf Jahren
- bei Freiheitsstrafen von über 5 bis 10 Jahren in zehn Jahren
- bei Freiheitsstrafen von über 10 Jahren in 20 Jahren
- bei lebenslangen Freiheitsstrafen in 30 Jahren
Grundsätzlich ist es also nicht einfach, auf den ersten Blick zu beurteilen, ob beispielsweise ein fünf Monate alter Bußgeldbescheid bereits verjährt ist. Darüber hinaus kann die Verjährung auch unterbrochen werden. Gerne prüfe ich solche Bescheide für Sie und unterstütze Sie bei den weiteren Schritten.
Was unterbricht oder hemmt die Verjährung?
Dass diese Verjährungsfristen gelten, muss nicht bedeuten, dass die Tat nach dem Ablauf der Frist auf jeden Fall verjährt ist. Es gibt verschiedene Handlungen, die eine Verjährung unterbrechen können. Diese sind in § 33 OWiG festgeschrieben. Wenn zum Beispiel die Zustellung eines Anhörungsbogens an Sie verfügt wird, in dem Ihr Name und der Tatvorwurf konkret genannt werden, unterbricht dies die Verjährungsfrist genauso, wie wenn Sie vernommen werden. Auch der Erlass und die Zustellung eines Bußgeldbescheids führen zu einer Unterbrechung. Sobald die Akte bei Gericht eingegangen und in den Geschäftsgang gelangt ist, also zur Weiterbearbeitung in den laufenden Verfahrensablauf eingeht, gilt die Verjährungsfrist ebenfalls als unterbrochen. Das gleiche gilt, wenn ein Strafbefehl erlassen wurde oder andere gerichtliche Maßnahmen, wie die Erhebung einer öffentlichen Klage, erfolgt sind.
Mit jeder solchen Unterbrechungshandlung beginnt die Frist von Neuem und es kann wieder zur Verjährung kommen. Dies setzt sich allerdings nicht unendlich lange fort: Bei Verkehrsordnungswidrigkeiten ist die Verjährungsfrist auch mit mehrmaligen Unterbrechungen auf zwei Jahre begrenzt. Ansonsten gilt als Grenze der doppelte Zeitraum der gesetzlichen Verjährungsfrist. Auch hier kann Ihnen meine umfassende Erfahrung und juristische Kompetenz dabei helfen, zu prüfen, ob die Verjährung eines Bußgeldbescheides möglicherweise unterbrochen wurde. Sollte tatsächlich eine Verjährung eingetreten sein, beantrage ich gerne bei der zuständigen Bußgeldstelle eine Verfahrenseinstellung für Sie.
Unterschiede in anderen Bereichen
Wie bereits deutlich geworden ist, hängt die konkrete Dauer der Verjährungsfrist davon ab, welche gesetzliche Grundlage im Einzelfall gilt. Dementsprechend kann es in einigen anderen Bereichen als dem Strafrecht zu noch weiteren Unterschieden kommen. Ein Beispiel hierfür ist das Steuerrecht: Hier gibt es immer zwei Verjährungsfristen zu beachten. Einerseits kann, etwa bei vorsätzlicher Steuerhinterziehung, die Strafverfolgung in einfachen Fällen schon nach fünf Jahren verjähren. Es gibt aber in diesem Fall noch eine Festsetzungsverjährungsfrist von zehn Jahren, innerhalb derer das Finanzamt Steuerbescheide ändern und auch Steuern nachfordern kann. Ein weiterer Unterschied ist, dass im Steuerrecht die Verjährungsfrist mit dem Ablauf des betreffenden Kalenderjahres beginnt.
Im Umweltrecht wiederum wird dem Umstand Rechnung getragen, dass Ordnungsverstöße hier häufig schwerwiegende und längerfristige Folgen haben als Verkehrsordnungswidrigkeiten. Die gesetzliche Grundlage bilden hier, je nach Sachlage, etwa § 62 Bundes-Immissionsschutzgesetz, § 103 Wasserhaushaltsgesetz, § 69 Bundesnaturschutzgesetz oder § 69 Kreislaufwirtschaftsgesetz. In Bezug auf die Verjährung verweisen diese wiederum auf die Regelungen des Ordnungswidrigkeitengesetzes. Aus den im Vergleich zu Verkehrsordnungswidrigkeiten oft deutlich höheren Bußgeldern ergeben sich dann auch längere Verjährungszeiträume.
Zusammenfassung und Fazit
Bei all der Regelungsvielfalt im Straßenverkehrsrecht wird deutlich: Einen Bußgeldbescheid einfach zu ignorieren, weil er ja schon verjährt sein müsste, ist nicht unbedingt die beste Idee. Es kann aber sehr sinnvoll sein, im Zweifelsfall zu prüfen, ob ein solcher Bescheid nicht bereits verjährt ist, da Sie so Punkte in Flensburg oder das Bußgeld sparen können. Gerne prüfe ich Ihren Bußgeldbescheid für Sie und leite gegebenenfalls weitere Schritte ein. Die Kosten werden übrigens üblicherweise durch eine Verkehrsrechtsschutzversicherung übernommen, wenn vorhanden.