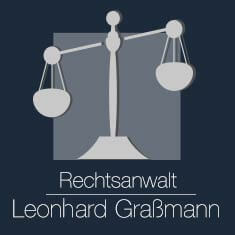Als Rechtsanwalt erlebe ich immer häufiger, dass Betroffene von Online-Belästigung zu mir kommen und fragen, ob „nur ein paar Nachrichten“ überhaupt rechtlich relevant sind. Die Antwort ist eindeutig: Ja, auch vermeintlich harmlose, wiederholte Kontaktaufnahmen können strafbar sein. In meiner täglichen Praxis im Sexualstrafrecht in München sehe ich, wie sehr Betroffene unter digitaler Belästigung leiden und gleichzeitig unterschätzen, welche rechtlichen Möglichkeiten ihnen zur Verfügung stehen. Der digitale Raum ist keineswegs rechtsfrei – im Gegenteil, das deutsche Strafrecht greift hier mit voller Härte.
Das Wichtigste in Kürze
- Online-Belästigung ist bereits bei wiederholter Kontaktaufnahme strafbar – auch „nur ein paar Nachrichten“ können als Nachstellung nach § 238 StGB verfolgt werden und selbst das einmalige Versenden von Nacktbildern (Cyberflashing) erfüllt Straftatbestände nach § 184 oder § 201a StGB.
- Das deutsche Strafrecht bietet umfassenden Schutz im digitalen Raum. Von Nachstellung über Pornografie bis hin zu Deepfakes und Doxxing greifen verschiedene Paragraphen mit Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren.
- Betroffene sollten sofort handeln und sich professionelle Hilfe holen – Beweise durch Screenshots sichern, Anzeige erstatten und spezialisierte Rechtsberatung in Anspruch nehmen.
Was gilt als sexuelle Belästigung im Netz?
Die Bandbreite digitaler sexueller Belästigung ist groß und beginnt bereits bei unerwünschten Nachrichten mit sexuellem Inhalt. Wenn Sie nach einer deutlichen Ablehnung weiterhin solche Nachrichten erhalten, liegt eine Belästigung nach § 184i StGB vor. Besonders problematisch ist das unaufgeforderte Versenden von Nacktbildern, das als Cyberflashing bezeichnet wird. Hier greifen sowohl § 184 StGB als auch § 201a StGB, selbst wenn es sich um eine einmalige Handlung handelt.
Eine neue Dimension erreicht die digitale Belästigung durch Deepfakes und KI-Manipulation, wo intime Bilder oder Videos auch ohne echtes Ausgangsmaterial erstellt werden. Diese Manipulationen verletzen das Persönlichkeitsrecht massiv und können verschiedene Straftatbestände erfüllen. Kombiniert mit Stalking-Verhalten und Doxxing – der Veröffentlichung privater Daten – entstehen komplexe Belästigungsszenarien, die das Leben der Betroffenen erheblich einschränken.
Welche Gesetze greifen bei Online-Belästigung?
Das deutsche Strafrecht bietet verschiedene Tatbestände, die bei Online-Belästigung greifen. Der wichtigste ist § 238 StGB zur Nachstellung, der wiederholtes Kontaktieren, unbefugten Datenzugriff oder Veröffentlichungen privater Informationen erfasst. Die Strafen reichen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe, in schweren Fällen sogar bis zu fünf Jahre.
Für pornographische Inhalte ist § 184 StGB relevant, der die Verbreitung solcher Materialien mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe bedroht. Der § 201a StGB erfasst Verletzungen der Intimsphäre, einschließlich Upskirting, mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe. Aktuell wird zudem ein eigenständiger § 201b StGB für Deepfake-Straftaten vorbereitet.
Bei rufschädigenden Manipulationen greifen die §§ 186–187 StGB zu übler Nachrede und Verleumdung. Drohungen und Erpressung werden über § 241 StGB und § 253 StGB erfasst, während § 126a StGB das Doxxing regelt. Zusätzlich bestehen zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Löschung.
So wehren sich Betroffene effektiv
Mein Rat als Anwalt: Sichern Sie sofort Beweise durch Screenshots, notieren Sie Metadaten und Chatverläufe und benennen Sie mögliche Zeugen und Zeuginnen. Nutzen Sie die Blockier- und Meldefunktionen der jeweiligen Plattformen und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei und Staatsanwaltschaft. Bei § 184i handelt es sich um ein Antragsdelikt, während § 238 im öffentlichen Interesse verfolgt werden kann.
Suchen Sie sich rechtliche Hilfe – spezialisierte Beratungsstellen wie der Weiße Ring oder HateAid können erste Unterstützung bieten, für die rechtliche Durchsetzung empfehle ich spezialisierte Rechtsanwälte und -anwältinnen. Zivilrechtlich können Sie einstweilige Verfügungen erwirken, Löschungsansprüche geltend machen oder Schadensersatz und Schmerzensgeld fordern.
Besonders brisante Fälle: Deepfakes, Hacking, Drohungen
Deepfakes und Revenge-Porn stellen eine besondere Herausforderung dar, da sie auch ohne Originalmaterial erstellt werden können. Diese fallen unter § 201a StGB, können aber auch Verleumdung oder Erpressung darstellen. Der geplante § 201b StGB soll diese Lücken schließen.
Hacking von E-Mail- oder Social-Media-Konten sowie die Installation von Stalkingware sind nach § 238 Abs. 1 Nr. 5–6 StGB strafbar. Drohungen und Erpressung per Chat oder E-Mail erfüllen zusätzliche Straftatbestände nach § 241 und § 253 StGB.
Rechtliche Grauzonen entstehen oft durch die Anonymität der Täter und Täterinnen oder deren Aktivitäten im Ausland, was die Strafverfolgung erschwert. Hier wirken sich auch EU-Regulierungen wie der Digital Services Act und der AI-Act aus, die Plattformen zu proaktivem Vorgehen verpflichten.
Zusammenfassung und Fazit
Der digitale Raum ist keineswegs rechtsfrei. Online-Belästigung trifft die volle Härte des deutschen Zivil- und Strafrechts. Häufiger als viele denken, werden Täter und Täterinnen rechtlich zur Verantwortung gezogen und Betroffenen stehen klare Schutzmechanismen zur Verfügung. Neue Technologien wie Deepfakes bringen zwar Rechtslücken mit sich, doch laufen bereits Reformen wie der geplante § 201b StGB und EU-Vorgaben dagegen.
Mein Appell: Zögern Sie nicht mit der Beweissicherung, Anzeige und rechtlichen Beratung. Das Gesetz wirkt – auch im digitalen Alltag. Als Ihr Anwalt für Sexualstrafrecht in München stehe ich Ihnen dabei zur Seite.